Immuntherapie bei Krebs – riskant und profitabel
Wenn für ein Zytostatikum wie Avastin offiziell von Seiten der FDA verkündet wird, die Substanz nicht mehr bei metastasierendem Brustkrebs einzusetzen, da die Substanz mehr schadet als nützt, dann kommt das fast einer Bankrotterklärung gleich.
Eigenartigerweise gilt diese Beschränkung nur für Brustkrebs, nicht aber für andere Krebsformen. Sehr wahrscheinlich wäre eine generalisierte Beschränkung eine Vorwegnahme einer Rücknahme vom Markt. Es gibt noch andere Zytostatika. Aber auch hier gibt es ein fragwürdiges Nutzen-Risiko-Verhältnis. Denn eine lebensverlängernde Wirkung ist für keines dieser Medikamente nachgewiesen worden (Bekanntes Krebsmedikament: Mehr Schaden als Nutzen?).
Nachdem sich langsam in der evidenzbasierten Schulmedizin der Verdacht breitmacht, dass die „klassischen“ Chemotherapeutika trotzt Milliarden hohem Forschungsaufwand nicht die Wirkung entfalten, auf die man stolz hätte sein können, verfällt man auf die Idee, neue Therapiekonzepte in die Welt zu setzen. Und eins dieser neuen Konzepte ist die Krebsimmuntherapie.
Wie schon damals, wo jedes neue Zytostatikum als neuer „Durchbruch“ gefeiert wurde, und dann in der Versenkung verschwand, wird selbstverständlich dieses neue Therapiekonzept auch als Durchbruch angepriesen.
Dementsprechend heftig wird die Werbetrommel gerührt. Die Immuntherapie gegen Krebs ist der neue Hoffnungsträger, den die Pharmaindustrie sich dementsprechend gut bezahlen lässt. Manche dieser Werbekampagnen erinnern mich an „Wundermittel“, die sonst nur von Esoterikern angeboten werden. Ähnliche Allheilmittel mit entsprechenden Versprechungen kennen wir ja bereits von den einschlägigen Kampagnen.
Es ist fast gleichgültig, ob es Impfungen sind, die alten Chemotherapeutika, oder jetzt die neuen immunologischen Verfahren; es wird nur über den grünen Klee gelobt. Nebenwirkungen gibt es entweder keine oder aber selbige sind nicht der Rede wert. Wenn man dann aber unter „Drugs.com“ nach den Nebenwirkungen von Impfungen oder den entsprechenden Krebstherapien fahndet, dann wird das Legoland-Marketing schnell von der schulmedizinischen Wirklichkeit eingeholt. Die Liste der schweren und schwersten Nebenwirkungen ist in der Regel ellenlang.
Das alte „Neue“ in der Immuntherapie
Wenn Alternativmediziner natürliche Heilungsprozesse zugunsten der Genesung eines Kranken ausnutzen möchten, dann betrachtet die Schulmedizin dies in der Regel als Humbug. Sie nennt das auch: „Nicht evidenzbasiert.“ Jetzt aber, mit der Immuntherapie, wird genau dieses Prinzip als Neuentdeckung der Schulmedizin gehandelt. Denn hier sollen die körpereigenen Abwehrmechanismen genutzt werden, um die Krebserkrankung zu bekämpfen. Was früher als esoterischer Humbug galt, wird im weißen Gewand der Schulmedizin, und auch nur da, plötzlich zur frohen Heilsbotschaft.
Wie soll das erfolgen?
Bei einem holistischen Therapieansatz würde der Therapeut alles tun, um das körpereigene Immunsystem so zu stärken, dass es erfolgreich gegen den Krebs vorgehen kann. Die schulmedizinische Immuntherapie dagegen scheint davon auszugehen, dass das Immunsystem nur dann ein Immunsystem ist, wenn man ihm Substanzen aus der Retorte verabreicht. Aber schon aus wirtschaftsideologischer Sicht darf ein Immunsystem nicht selbstständig handeln. Wenn dem so wäre, dann bräuchte niemand synthetische Substanzen, die man patentieren und für teures Geld verkaufen kann.
Das Spiel mit dem Immunsystem scheint seinen Preis zu haben. Denn das Immunsystem kümmert sich herzlich wenig um die Vorgaben der Marketingabteilungen. Denn Medikamente, die das angeblich so minderwertige Immunsystem erst einmal richtig auf Trab bringen sollen, damit es überhaupt in der Lage ist, gegen Tumorzellen vorzugehen, können unvorhersehbare Folgen zeitigen. Dieses „auf Trab bringen“ kann darin enden, dass das Immunsystem nicht nur Tumorzellen, sondern gleich ganze Gewebe und Organe angreift und zu einem multiplen Organversagen führt.
Basis für die meisten Konzepte der Krebsimmuntherapie sind die sogenannten Tumorantigene. Man kennt bis heute rund 2000 solcher Antigene. Man geht davon aus, dass diese spezifischen Antigene folgende Charakteristika aufzeigen:
- Sie kommen nur auf der Zellmembran von Tumorzellen vor. Gesunde Zellen weisen sie nicht auf. Es handelt sich hier um ein tumorspezifisches Antigen.
- Die Präsenz (Expression) der Antigene auf der Membranoberfläche ist idealerweise während des gesamten Zellzyklus und in hoher Dichte gegeben.
- Das Tumorantigen ist spezifisch und typisch für alle Krebszellen und Krebsformen.
Damit wäre auch das Therapiekonzept klar: Krebs ist weitestgehend die Unfähigkeit des Immunsystems, tumorspezifische Antigene zu erkennen. Und hier kann die Schulmedizin Abhilfe schaffen.
Aber auch hier sieht die Realität viel komplizierter aus als man es in der Schulmedizin wahrhaben möchte. Denn die meisten Tumorantigene sind eben nicht tumorspezifisch, sondern bestenfalls tumorassoziiert. Das heißt, dass diese Antigene auch auf gesunden Zellen vorkommen, allerdings in einer deutlich geringeren Dichte.
Das heißt für das Konzept der Immuntherapie, dass eine Sensibilisierung des Immunsystems für bestimmte Tumorantigene immer die Gefahr mit sich bringt, das Immunsystem so zu aktivieren, dass es auch gesunde Zellen mit den entsprechenden Antigenen versucht zu eliminieren. Daher ist die Identifizierung von Tumorantigenen beim Patienten mit einer bestimmten Krebserkrankung fast mit einer Sisyphusarbeit zu vergleichen.
In diesem Zusammenhang taucht dann wieder der Begriff einer individualisierten Therapie auf, den man so eigentlich nur von „alternativmedizinischen Esoterikern“ her kennt. Jedenfalls ist eine konsequent durchgeführte Suche nach spezifischen Tumorantigenen für eine optimale Therapie für jeden einzelnen Patienten für die Pharmaindustrie keine verlockende Aussicht. Denn Profite werden hier nur mit Medikamenten gemacht, die nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden.
Aber dieses Gießkannenprinzip sorgt dafür, dass die entsprechenden Fehlreaktionen auftreten: PD-1 ist ein Protein, das auf der Membranoberfläche von T- und B-Zellen als Rezeptor fungiert. Der Rezeptor bindet an zwei Liganden, PD-L1 und PD-L2. Diese Liganden liegen auf den Membranen von Körperzellen, können aber auch in hoher Dichte auf Tumorzellen vorkommen. Bindet PD-1 mit PD-L1 oder -L2, dann signalisiert dies dem Immunsystem, dass die Zelle zum körpereigenen Reservoir gehört.
PD-1 dient als immunologischer Kontrollpunkt und hat eine zentrale Rolle bei der Dämpfung des Immunsystems, um Autoimmunreaktionen zu vermeiden. Der hemmende Effekt von PD-1 wird durch einen Doppelmechanismus bewerkstelligt, der zum einen eine Apoptose in antigenspezifischen T-Zellen auslöst, und gleichzeitig die Apoptose von Suppressor-T-Zellen hemmt.
Das heißt also, dass eine Immuntherapie hier PD-1 Rezeptoren blockiert, die damit nicht mehr in der Lage sind, die auf dem Tumor befindlichen PD-L1 Rezeptoren zu binden.
Die Folge ist, dass der Tumor vom Immunsystem als körperfremdes Objekt klassifiziert wird. Oder mit anderen Worten: Ein deaktivierter Kontrollpunkt gibt dem Immunsystem freie Bahn für den Angriff auf alle Zellen, deren PD-L1 Rezeptoren nicht von PD-1 blockiert sind.
Die Hypothese der schulmedizinischen Krebsimmuntherapie besteht jetzt darin, zu unterstellen, dass die PD-L1 Rezeptoren überdurchschnittlich hoch auf Krebszellen exprimiert werden. Die Krebszellen versuchen durch diesen Trick das Immunsystem zu überlisten und sich als körpereigene Struktur auszugeben. Das Konzept besticht durch seine Logik und sollte doch eigentlich der „Durchbruch“ sein, von dem die Schulmedizin so häufig faselt. So ist auch die englische Ausgabe von Wikipedia voll des Lobes über die PD-L1 Inhibitoren und vergisst dabei ohne zu zögern, auch etwas über mögliche Nebenwirkungen zu berichten. Nach Lesen dieses Beitrags hatte ich den Eindruck, dass es sich hier wirklich um den lang ersehnten „Durchbruch“ handeln muss.
Ein weiterer englischer Wikipedia Beitrag über den Rezeptor PD-L1 dagegen beschreibt kurz das Phänomen von Autoimmunreaktionen unter der Blockade von PD-1. Der Beitrag spricht hier von einer spontanen Entwicklung von Typ-1-Diabetes und anderen Autoimmunerkrankungen bei Mäusen. Inzwischen ist bekannt, dass nicht nur Mäuse diese Nebenwirkung aufzeigen. Diese Arbeit aus dem Jahr 2015 „Precipitation of Autoimmune Diabetes With Anti-PD-1 Immunotherapy“ beschreibt das plötzliche Einsetzen eines Typ-1-Diabetes bei 5 Patienten, die unter dieser Immuntherapie standen.
Die Geschwindigkeit, mit der der Diabetes bei den Patienten einsetzte, war nahezu atemberaubend: in nur einer Woche bis maximal fünf Monaten entwickelten die Patienten ihren insulinabhängigen Diabetes.
Bei so einer schnellen Reaktion gibt es kaum Möglichkeiten, hier entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Autoren betonen noch einmal, dass Diabetes eine neue Diagnose für alle Betroffenen war, mit Ausnahme eines Patienten, der bereits an Typ-2-Diabetes litt. Aber Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes sind klinisch vollkommen verschiedene Erkrankungen, die nur in ihrer Symptomatik entsprechende Gemeinsamkeiten haben. Alle betroffenen Patienten wurden somit schlagartig insulinpflichtig.
Grund für diese Entwicklung ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Tatsache, dass die Blockierung von PD-1 durch die Immuntherapie zu einer Fehlinformation bezüglich der insulinproduzierenden Betazellen geführt hatte, die in der Folge vom Immunsystem als „körperfremd“ kategorisiert und attackiert wurden. Und diese Variante ist nur eine Möglichkeit, wo es zu einem „Immununfall“ gekommen ist. Andere Autoimmunerkrankungen nach dieser Behandlungsform sind gleichermaßen beschrieben worden.
Da mag es wie ein makaberer Scherz erscheinen, wenn eine Krebstherapie zu einem Diabetes führt, der sicherstellt, dass der Patient dem Arzt erhalten bleibt, wenn er nicht an seinem Krebsleiden stirbt. Dieser Zynismus ist nicht von mir gewollt, sondern das Ergebnis einer Betrachtung aus Sicht der Marketingabteilung. Unter TOP 20 GLOBAL THERAPY AREAS 2015 von „imshealth“ können wir sehen, dass Krebs mit fast 80 Milliarden Dollar pro Jahr das einträglichste Geschäft ist – gefolgt von Diabetes mit über 70 Milliarden Dollar.
Zufall? Sehr wahrscheinlich.
Aber für das Geschäft ein Geschenk des Himmels, oder?
Und wenn man sich einmal die Steigerungsraten im Vergleich zum Jahr 2014 anschaut – 14 Prozent Steigerung bei Krebstherapien und 19 Prozent bei Antidiabetika.
Davon träumen die meisten Unternehmen!
Die Autoimmunerkrankungen folgen dann schon auf Platz 4 mit 41 Milliarden Dollar und einer Wachstumsrate von fast 20 Prozent. Hier stellt man sich fast reflexartig die Frage, ob auch diese Wachstumsraten von den neuen Krebsimmuntherapien mit angekurbelt werden.
Langsam glaube ich auch an den „Durchbruch“, leider nicht in Sachen Heilung, sondern in Sachen Geschäft und dessen Nachhaltigkeit und Langzeiteffizienz für die Umsätze.
Hier sind die Kosten für die neuen Immuntherapien noch gar nicht mit berücksichtigt worden. Man erwartet für das Jahr 2021 Umsätze für Krebsmedikamente von über 160 Milliarden Dollar. Da ist man geneigt, den alten Karnevalshit anzustimmen: „Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke-Pinke, wer hat so viel Geld?“.
Natürliche Alternativen
Die klassischen Zytostatika sind Krebsmittel, die Krebs erzeugen können, statt zu bekämpfen. Für die Pharmaindustrie heißt es, nach Alternativen zu suchen, die sich patentieren und verkaufen lassen. Hier dienen natürliche Verfahren nur als Vorbild für die Schaffung von synthetischen Lösungen.
Denn Selbstheilungskräfte sind ökonomisch kontraproduktiv und potentiell geschäftsschädigend, da man sie nicht patentieren kann und möglicherweise wirkungsvoller sind als die eigenen Produkte. So ganz nebenbei: Dies könnte auch die Frage beantworten, warum es so gut wie keine vergleichenden Studien gibt, wo natürliche Substanzen und deren Effektivität mit der von synthetischen Substanzen verglichen werden.
Wie könnten die natürlichen Alternativen aussehen?
Die Palette an Möglichkeiten ist umwerfend groß. Sie ist so groß, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Hier eine Liste an Beiträgen, die diese Möglichkeiten reflektiert (in zufälliger Reihenfolge):
- Heilpilze – Heilung durch Pilze?(Mykotherapie)
- Der Coriolus Pilz (Trametes versicolor): Wirkung und Studien zu diesem erstaunlichen Heilpilz
- Universelles Heilmittel aus Asien: der Reishi-Pilz; Eine interessante Monografie dazu von „Cancer Research UK“: Cancer Research (UK) on Medicinal mushrooms
- Beta-Glucan: Anwendung, Wirkung und Nutzen
- Fasten bei Krebs – Erstaunliche Erkenntnisse
- Angiogenese oder: Wie esse ich gegen Krebs?
- Krebsleiden – Krebserkrankungen in der Naturheilkunde und der Alternativmedizin
- Homöopathie im Einsatz gegen Krebs
- Fünf Tipps gegen Krebs
- Wird das Naturheilmittel Cannabis als Hilfe gegen Krebs unterdrückt? (Ein weiterer Beitrag zu diesem Thema ist in Arbeit)
Fazit
Die neuen schulmedizinischen Methoden der immunologischen Krebstherapie sind nichts anderes als eine gefährliche Einflussnahme auf das Immunsystem der Patienten mit den entsprechenden desaströsen Nebenwirkungen.
Die Effektivität dieser Therapien wird nach alter und erfolgreicher Manier gebetsmühlenartig herbei diskutiert, nachdem man Nebenwirkungen und Therapieversager als unbedeutend unter den Tisch hat fallen lassen. Denn angesichts der Umsätze und der zukünftigen Umsatzprognosen darf so eine Therapie nicht versagen. Das ist der „Durchbruch“.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter dazu an:
Vor allem wenn Sie für den Erhalt der Homöopathie sind, sollten Sie sich unbedingt dazu eintragen, denn die „Politik“ und etablierte Medizinerschaft ist bestrebt die Homöopathie zu verbieten und / oder abzuschaffen!
Beitragsbild: 123rf.com – ralwel
 Rene Gräber:
Rene Gräber:
Ihre Hilfe für die Naturheilkunde und eine menschliche Medizin! Dieser Blog ist vollkommen unabhängig, überparteilich und kostenfrei (keine Paywall). Ich (René Gräber) investiere allerdings viel Zeit, Geld und Arbeit, um ihnen Beiträge jenseits des „Medizin-Mainstreams“ anbieten zu können. Ich freue mich daher über jede Unterstützung! Helfen Sie bitte mit! Setzen Sie zum Beispiel einen Link zu diesem Beitrag oder unterstützen Sie diese Arbeit mit Geld. Für mehr Informationen klicken Sie bitte HIER.

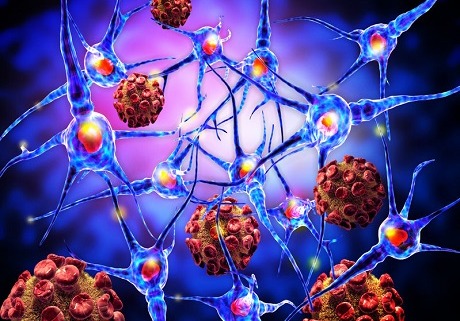
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!